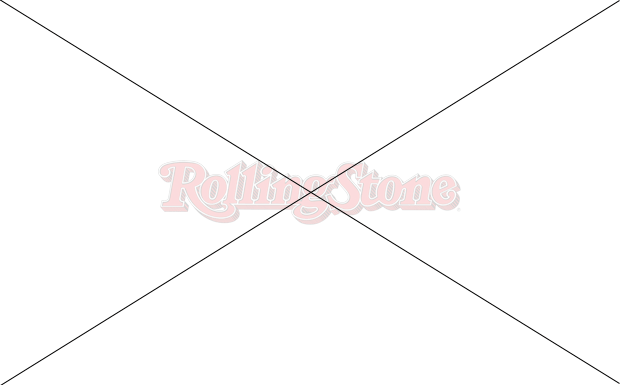Bon Iver
Bon Iver
4AD/Beggars Group/Indigo
Und wieder einer: ein singender Bart aus Amerika. Irgendwann mal war es ein Witz, jetzt ist es schon eine Genrebezeichnung. Für den magischen Landhaus-Realismus, die Grenzregion zwischen Appalachen und Brian-Wilson-Gedankengebirgen. Den einerseits wahnsinnig altmodischen und doch irrsinnig progressiven Folk von Iron & Wine oder Fleet Foxes, William Fitzsimmons oder Scott Matthew. Mittlerweile gibt es sogar schon singende Bärte, die gar keinen Bart haben. Sufjan Stevens zum Beispiel.
Aber so leise, struppig und schrullig diese Musik auch daherkommt – das zweite Album von Justin Vernon alias Bon Iver, 30, aus Wisconsin, ist schon jetzt ein gewaltiges Ereignis. Weil das erste, „For Emma, Forever Ago“ von 2008, bei einem unfassbar großen Publikum die inneren Hackbrettsaiten zum Schnarren brachte. Sogar der streng auf Großartigkeiten spezialisierte Rapper Kanye West ließ Justin Vernon bei sich mitsingen – weil West natürlich gemerkt hatte, dass es bei den daseinsmüden, meist mit himmelwärts summender Kopfstimme vorgetragenen Bon-Iver-Stücken nicht etwa um Feld, Wald und Herzschmerz geht, sondern um die Suche nach Erleuchtung, Entgrenzung. Nicht nach Gott (auch Bartträger!), aber nach einem, der so ähnlich aussieht.
Dieses stille Glühen wird auf der neuen Platte immer intensiver. Das Projekt Bon Iver scheint jetzt eine echte Band zu sein, ein Ensemble mit zerzausten Köpfen, mit Banjos und Steelguitar, manchmal Bläsern, Synthesizern und anderen, rätselhaften Vibrationsinstrumenten. Alles mit dem Fingerkuppengefühl, dem unendlich sanften Druck gespielt, wie man ihn sonst nur vom Jazz oder vom Postrock der 90er-Jahre kennt.
Man kann ja auch Herzen brechen, ohne irgendwem wehzutun. Vernons Falsettgesang und die aus den zehn Stücken nebelnden Melodien erreichen alles scheinbar nebenbei: Das Selbstmitleid und brüchige Schluchzen, mit dem mancher singende Bart sich uns aufgedrängt hat, fehlt bei Bon Iver völlig. Und wenn er in „Minnesota“ immer wieder „Now I’m gonna break“ fistelt, über ein gezupftes Gitarrenmotiv und das meditative Schwärmen von Mellotron, Steel-Saiten und einsamen Free-Jazz-Bläsern – dann könnte man glauben, das wäre nur der feierliche Nachhall des eigentlichen Songs, aufgenommen durch die Holzwand hindurch, während die Musiker selbst schon längst zum Himmel oder sonst wohin gefahren sind.
Wie so oft ist das auch die Schwäche: Man kann „Bon Iver“ sehr oft hören, ohne sich hinterher an irgendetwas zu erinnern. Nichts an dieser Musik erscheint greifbar, kein Thema bleibt hängen. Dabei ist es gerade das, was bei Künstlern wie Will Oldham oder Bill Callahan, den Ahnvätern der Bärte, bis heute fasziniert: dass ihre Songs auch Dichtung und Wahrheit transportieren. Bon Iver, zu dem Schluss kommt man auch am Ende dieses schönen Albums wieder, hat uns nichts mitzuteilen. Vielen reicht das trotzdem.
Hier geht’s zum Stream des neuen Albums.